Komplikation nach Infektionskrankheiten: Was steckt hinter Long-Covid?
Nach einer Infektionserkrankung genesen die meisten Menschen ohne weitere Folgen. Andere hingegen fühlen sich anhaltend erschöpft, selbst kleinste Anstrengungen wie das Umdrehen im Bett werden zum Kraftakt. Symptome wie dieses sind mit Long-COVID- und Post-COVID-Syndrom ins Rampenlicht gerückt. Bekannt sind Langzeitfolgen nach Infektionen bereits seit vielen Jahren. Erforscht sind sie kaum. Wissenschaftler:innen der Charité wollen nun klären, was der komplexen neuroimmunologischen Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) zugrunde liegt.
Häufig anhaltende Schwäche und Erschöpfung
Die langfristigen Folgen von COVID-19 treten mit Voranschreiten der Pandemie immer stärker zutage. So steigt die Zahl dauerhaft eingeschränkter und behandlungsbedürftiger Menschen stetig an. Gleichermaßen wächst der Bedarf an belastbarem Wissen über mögliche Spät- und Langzeitfolgen. ME/CFS ist eine schwerwiegende, meist lebenslang andauernde Erkrankung mit unterschiedlich ausgeprägten Symptomen. Am häufigsten kommt es zu Schwäche und Erschöpfung (Fatigue) sowie Muskel- und Kopfschmerzen. Aber es werden auch Darmbeschwerden, Schwindel, Stress- und Reizempfindlichkeit, Herzrasen oder Blutdruckschwankungen beobachtet. Dabei tritt eine Verschlechterung typischerweise schon infolge geringfügiger Belastungen ein.
Viele Patienten unter 18 Jahren
Bei der Mehrzahl der Patient:innen beginnt die Krankheit nach einer Virusinfektion. Verschiedene Erreger sind mittlerweile als Auslöser bekannt, darunter Herpesviren wie das Epstein-Barr-Virus, Dengue- oder Influenza-Viren. Nach der SARS-Pandemie 2002 und 2003 entwickelte ein Teil der Erkrankten auch ME/CFS. In der aktuellen COVID-19-Pandemie zeigt sich, dass eine Untergruppe der Long-COVID-Betroffenen ebenfalls an ME/CFS erkrankt. Bereits vor Pandemiebeginn gingen Expertenschätzungen von etwa 300.000 Menschen alleine in Deutschland aus, die an der chronischen Erkrankung leiden. Rund 40.000 von ihnen sind noch keine 18 Jahren alt. Etwa die Hälfte der überwiegend jüngeren und weiblichen Patienten ist so krank, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Schwerstbetroffene sind bettlägerig und nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. Während man lange Zeit davon ausging, es handele sich um eine psychosomatische Erkrankung, stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ME/CFS bereits 1969 als neurologische Krankheit ein.
Genaue Ursachen sind unklar
Die genauen Mechanismen, die zur Erkrankung führen, sind bis heute ungeklärt. Jüngste Studien weisen auf autoimmune Prozesse hin. Diese scheine eine Fehlregulation des vegetativen Nervensystems sowie des zellulären Energiestoffwechsels auszulösen. Doch noch immer fehlen zugelassene und wirksame Behandlungsmöglichkeiten. Zudem fehlt es auch an verlässlichen Biomarkern oder messbaren Blutwerten zur Diagnostik. Dies zu ändern, hat sich eine Forschungsgruppe der Charité unter der Leitung von Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen zum Ziel gemacht. Bereits seit vielen Jahren ist Prof. Scheibenbogen mit dem Krankheitsbild des postinfektiösen Chronischen Fatigue Syndroms befasst. „Ich freue mich sehr über die Förderung dieses Verbundprojekts und darüber, es mit einem Team von Expertinnen und Experten für ME/CFS, COVID-19 und Immunsystem bearbeiten zu dürfen. Es kommt zur richtigen Zeit, denn das Thema postinfektiöse Erkrankungen hat in Folge der Pandemie eine neue Dimension bekommen“, sagt Prof. Scheibenbogen. „Es ist das erste Mal, dass nun ein Forschungsnetzwerk zu ME/CFS in Deutschland gefördert wird.“
Welche Rolle spielen Autoantikörper?
Was also führt zu der neuroimmunologischen Langzeiterkrankung, bei der bislang nur einzelne Symptome behandelt werden können, nicht aber die eigentliche Ursache? Das Epstein-Barr-Virus, welches das Pfeiffersche Drüsenfieber hervorruft, ist bereits nachweislich als Auslöser von Autoimmunreaktionen bekannt. Ein ähnliches Risiko für Autoimmunität vermutet das Forschungsteam nach COVID-19. Während im gesunden Menschen Autoantikörper zur Steuerung von wichtigen Vorgängen beitragen, können sie sich nach Infektionen in ihrer Funktion ändern und zur Entwicklung von Autoimmunerkrankungen führen. Im Fall von ME/CFS konnten Wissenschaftler:innen Autoantikörper gegen Schlüsselproteine in der Signalvermittlung nachweisen, die mit der Schwere von Symptomen in Zusammenhang stehen. Unter ihnen sind solche, die sich gegen Stressrezeptoren richten und mit Hauptsymptomen wie Erschöpfung und Muskelschmerzen verknüpft sind. Andere wiederum stehen mit verminderten kognitiven Fähigkeiten in Verbindung.
Enge Zusammenarbeit im Forschungsnetzwerk
Welche Rolle dabei einzelne Autoantikörper und kreuzreagierende Virus-Antikörper spielen, dem geht das neue Forschungsnetzwerk in fünf Teilprojekten nach. Dabei werden unterschiedliche Parameter innerhalb der einzelnen Projekte gesammelt und zusammen in einer Datenbank ausgewertet. Ziel der Arbeiten ist es, erstmals eine systematische, umfassende Grundlage für diagnostische Marker zu schaffen. Insbesondere hoffen die Forschenden, dass es gelingt, Strukturen zu identifizieren, die als Grundlage für gezielte Therapieansätze der Autoimmunerkrankung dienen. Die Hypothese des Teams um Prof. Scheibenbogen ist, dass einige der Autoantikörper in ihrer Struktur verändert sind. Binden diese an bestimmte Rezeptoren, könnte dies zu Fehlinformationen in den Zellen führen. Fehlfunktionen bei immunologischen, regulativen oder Stoffwechselprozessen wären die Folge. Dies soll nun genauer untersucht werden. Dabei arbeiten mehrere Forschungsgruppen aus ganz Deutschland innerhalb des Netzwerks zusammen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Arbeiten in den kommenden drei Jahren mit rund zwei Millionen Euro.
Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

 Pixabay
Pixabay
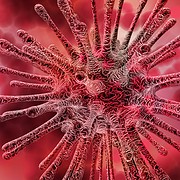

 Foto von Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/de-de/foto/arm-hande-frau-festhalten-8830485/
Foto von Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/de-de/foto/arm-hande-frau-festhalten-8830485/


